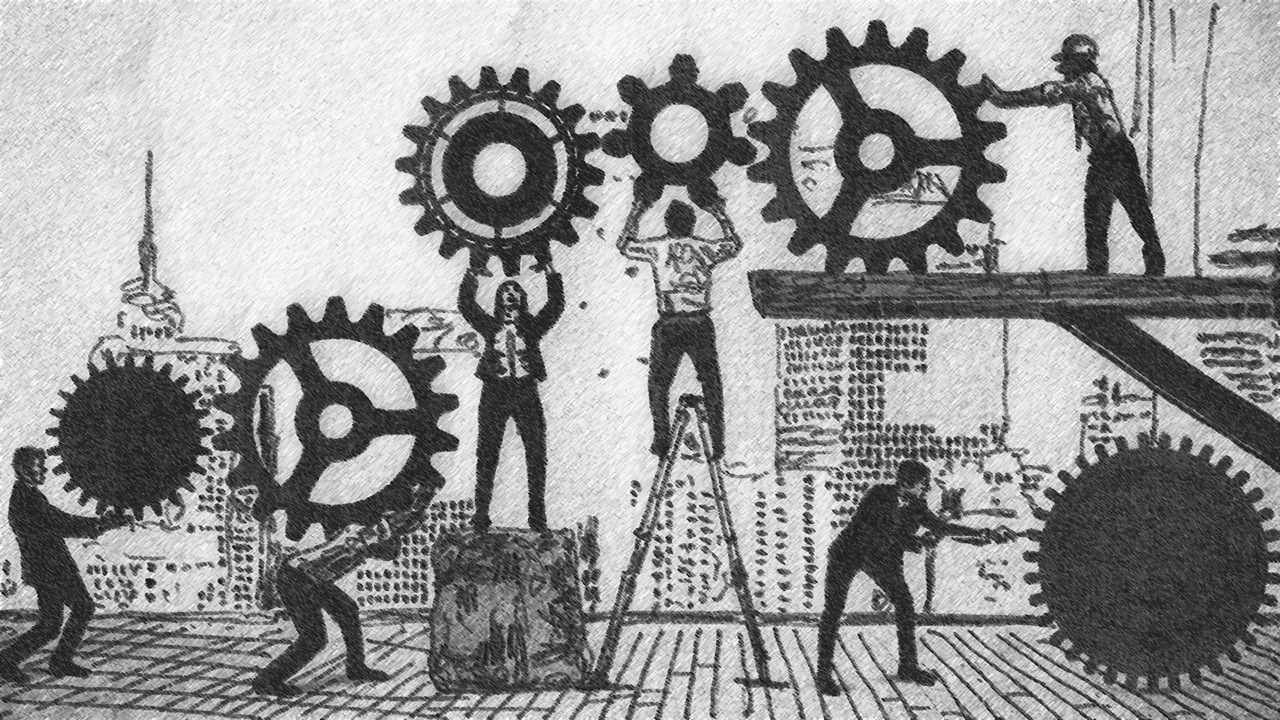„Arbeit 4.0“ oder „Industrie 4.0“. Zwei Stichworte, die wir in letzter Zeit häufiger lesen. Durch die Digitalisierung wird sich das Wesen der Arbeit verändern. Allerdings stellt sich dabei die Frage, welche Rolle der Mensch in dieser Entwicklung einnehmen wird. Ein Interview mit Dirk Heilmann, Chefökonom beim Handelsblatt.
Lieber Herr Heilmann, aktuell fallen einem in der deutschen Wirtschaftspresse immer wieder die beiden Schlagworte „Arbeit 4.0“ und „Industrie 4.0“ ins Auge. Wie betrachten Sie die Debatte, die mit diesen beiden Begriffen zusammenhängt?
Die Debatte zeigt auf jeden Fall, dass die Digitalisierung in der deutschen Wirtschaft angekommen ist und dass die Unternehmen nun daran arbeiten, die damit verbundenen Chancen zu nutzen. Das drückt Industrie 4.0 aus meiner Sicht erstmal aus. Es geht um die Digitalisierung der Industrie, ihrer Prozesse und Geschäftsmodelle. Wenn von Innovation in Deutschland die Rede ist, sind wir schnell bei der Automobilindustrie angelangt und bei den Ingenieuren.
Was wir dagegen häufig vergessen, ist die Tatsache, dass Innovation längst nicht nur in diesem Sektor zu finden ist. Wie erklären Sie sich die häufig vollkommen einseitige Fokussierung auf den Ingenieurbereich in Deutschland?
Das scheint eine Kosten- und Nutzenabwägung zu sein. In den ingenieurgetriebenen Wirtschaftszweigen ist Deutschland im internationalen Vergleich sehr gut positioniert, während wir zum Beispiel in der IKT-Branche (IKT = Informations- und Kommunikationstechnologie) der internationalen Konkurrenz eher hinterherlaufen. Wir konzentrieren unsere Kräfte also auf die Bereiche, in denen wir gut sind. Aber auch dort werden wir nicht darum herum kommen, neue Kompetenzen aufzubauen. Der Perfektionismus deutscher Ingenieure muss eine Verbindung mit der spontanen, opportunistischen Arbeitsweise der Digitalwirtschaft eingehen. Das wird nicht einfach.
Sie selbst sind der Auffassung, dass Kreativität in der Ausbildung hierzulande – etwa in der Ausbildung von Technikern – zu wenig gefördert wird. Worin besteht das Problem?
Die Methoden der Bildung und Ausbildung fördern stark einseitig die Fähigkeiten, die ein Computer besser beherrscht als jeder Mensch. Nämlich logisches Schlussfolgern, Merkfähigkeit und das möglichst schnelle Verarbeiten von Informationen – kurz die Fähigkeiten, die durch Intelligenztests abgeprüft werden. Das sind wichtige Fähigkeiten, doch Computer sind darin besser. Der eigentliche Vorteil des Menschen gegenüber dem Computer liegt in seiner Kreativität.
Die Kreativität wird allerdings durch die gängigen Bildungsmethoden und -schwerpunkte unterminiert – worauf Studien zur Entwicklung der Kreativität und anderer Kompetenzmerkmale hinweisen. Bitte nicht falsch verstehen: Die Förderung der Intelligenz ist wichtig, denn sie scheint auch zur Kreativität beizutragen. Wird sie allerdings einseitig gefördert, verkümmern die kreativen Talente und das Potenzial wird bei Weitem nicht genutzt.
Studien zeigen übrigens, dass die einseitige Förderung von Kompetenzmerkmalen wie der Intelligenz oder der Kreativität auch dazu führt, dass selbst die geförderte Kompetenz – in unserem Fall die Intelligenz – ihr volles Potenzial nicht entfalten kann. Das Problem mit dem starken Fokus auf den MINT-Fächern ist nun, dass damit ein zu starker Schwerpunkt auf die Kompetenzdimension Intelligenz gelegt wird, weil sie auf den ersten Blick ausreicht, um zum Beispiel einen fähigen Ingenieur zu beschreiben.

Im 20. Jahrhundert ging es immer wieder um die Frage, ob eine Maschine ein dem Menschen gleichwertiges Denkvermögen hat, etwa im Turing Test.
Die Forderung nach mehr Technikern impliziert ja auch die Annahme, dass es darum gehen sollte, sich als Mensch dem Computer anzugleichen und nicht umgekehrt. Das führt dann automatisch zu folgender Frage: Worin bestehen die spezifischen Fähigkeiten von Menschen, die Computer nicht erwerben können?
Vielleicht sind Sie mit den Unvollständigkeitssätzen Kurt Gödels vertraut. Sie sagen im Grunde aus, dass innerhalb eines ausreichend komplexen logischen Systems immer Probleme abgeleitet werden können, die mit den Mitteln dieses Systems nicht lösbar und damit unentscheidbar sind. Das bedeutet, dass es entgegen der landläufigen Annahme, in der Logik gäbe es immer entweder Wahr oder Falsch (1 oder 0), auch ein Unentscheidbarkeit gibt. Nicht alle Entscheidungen lassen sich also formal ausdrücken.
Die Algorithmen, die dem Computer seine Arbeitsanweisungen geben, sind aber nichts anderes, als formale komplexe logische Systeme, die nur Entscheidungen treffen können, die formal entscheidbar sind. Der Mensch hingegen hat den Vorteil, dass er Entscheidungen auch dann treffen kann, wenn sie sich nicht formal ausdrücken lassen. Er kann also auch Informationen hinzuziehen, die bisher nicht in dem „System“ enthalten waren und so eine Lösung finden, die darin nicht angelegt war. Diese Fähigkeit „außerhalb des Systems zu denken“ bzw. auch über gegebene Informationen und formale Regeln hinaus denken zu können, kann man auch Kreativität nennen – sie ist der entscheidende Unterschied zwischen Mensch und Computer.
Die Förderung der Intelligenz ist wichtig, denn sie scheint auch zur Kreativität beizutragen. Wird sie allerdings einseitig gefördert, verkümmern die kreativen Talente und das Potenzial wird bei Weitem nicht genutzt. – Dirk Heilmann
Der Philosoph und Informatiker Mihai Nadin äußerte in einem Interview in der Brand Eins zum Schwerpunkt Geschwindigkeit (Heft 12, Dezember 2015) den Gedanken, dass die Vorstellung, dass Maschinen eines Tages den Menschen beherrschen könnten, völlig unbegründet sei. „Diese Furcht ist insofern unbegründet, weil Maschinen nicht über die Fähigkeit verfügen, die uns ausmacht: Der heute noch dominierende algorithmische Computer kann Fragen beantworten, aber keine formulieren. Er hat kein Vorstellungsvermögen.“ Wie betrachten Sie diese Ansicht?
Man könnte dieser Ansicht mit Alan Turing entgegentreten, dem englischen Mathematiker, der den Turing-Test für künstliche Intelligenz entwickelt hat. Er schlug Folgendes vor: Anstatt danach zu fragen, ob ein Computer denken kann oder Vorstellungsvermögen hat, sollte man fragen, kann ein Computer einer Person glaubhaft machen, er sei ein Mensch. Denn was für einen Unterschied macht es letztlich, wenn der Mensch am anderen Ende gar nicht merkt, dass er einem Computer gegenüber sitzt. Wenn wir uns die Entwicklung der sogenannten künstlichen Intelligenz anschauen, liegt es nahe, dass es für einen Computer wie Watson bereits heute kein Problem mehr ist – vielleicht unter bestimmten Bedingungen – einem Menschen vorzugaukeln, er sei ein Mensch. Von dieser Schlussfolgerung ausgehend, ist es durchaus vorstellbar, dass Menschen von Computern beherrscht werden können.

1997 ereignete sich dann der Supergau. Ein Großmeister – der Russe Garry Kasparov – wurde 1997 das erste Mal von einem Supercomputer im Schach geschlagen. Eine echte Niederlage! Heute stellen wir uns angesichts der digitalen Transformation eine ganz andere Frage: Wie können sich Menschen und Computer gegenseitig ergänzen? Die Symbiose von kreativem Denken und enormer Rechenleistung.
Als 1997 der damalige Schachweltmeister Garri Kasparow gegen den Supercomputer „Deep Blue“ verlor, sahen viele darin die ultimative Niederlage des menschlichen Geistes gegen den Computer. 2005 veranstaltete Playchess.com das erste „Freestyle“-Schachturnier, bei dem weder ein Schach-Großmeister noch ein Superrechner gewann, sondern Schach-Amateure mit Laptops. Zu welcher Erkenntnis führt uns dieses Beispiel?
Das Beispiel des „Freestyle“-Schachturniers zeigt sehr gut, wie sich Mensch und Computer ergänzen. Die Gewinner des Turniers waren diejenigen, die den Computer am besten einzusetzen wussten und nicht diejenigen, die versuchten, mit dem Rechner zu konkurrieren. Im Schach kann der Computer mit seiner Rechenkraft und -geschwindigkeit die taktischen Anforderungen eines Schachspiels viel besser erfüllen als ein Mensch. Konkret heißt das, ein Computer kann viel mehr Züge in viel kürzerer Zeit vorausberechnen. Mit diesen Informationen kann der menschliche Schachspieler sich ganz auf die Strategie konzentrieren. Seine kognitiven Ressourcen sind nun von den ressourcenintensiven taktischen Aufgaben befreit und er kann über die einzelnen Züge hinaus seine ganze Kreativität darauf verwenden, Ideen zu entwickeln, wie er den Gegner schlagen kann.
Sie selber schreiben auch, dass momentan noch wenig darüber diskutiert wird, welche Qualifikationen die Arbeitskräfte von morgen benötigen, wenn wir einmal von MINT-Absolventen absehen: Mathematiker, Informatiker, Naturwissenschaftler und Techniker. Welche wären das denn Ihrer Meinung nach? Worüber ließe sich da diskutieren?
Die digitalisierte Wirtschaft wird technologiegetrieben sein, deshalb sind die MINT-Fächer für die Zukunft sehr wichtig. Nur: So, wie wir sie im Moment ausbilden, entwickeln wir in den Menschen vor allem die Fähigkeiten, die ein Computer viel besser beherrscht. In den MINT-Fächern muss Kreativität eine größere Rolle spielen. Auch auf der Ebene der Gesellschaft wird Kreativität ein noch wichtigerer Wettbewerbsfaktor. Deshalb ist es wichtig, die sogenannten weichen Fächer und Wissenschaften, aber auch Kunst und Kultur nicht zu vernachlässigen. Der Zeitgeist, dass alles einem unmittelbaren, möglichst wirtschaftlichen Zweck entsprechen muss, ist dafür nicht unbedingt zuträglich. Auf lange Sicht untergraben wir damit unsere Wettbewerbsfähigkeit eher, als dass wir sie steigerten.
Jetzt möchte ich noch einmal ein wenig zuspitzen. Im Zusammenhang mit technischer Kompetenz wird ja gerade vielfach auch über „Big Data“ diskutiert. Ist diese allgemeine Daten-Sammelei nicht auch dumm? Denn was bringen uns diese Daten ohne die Vorstellungsgabe und Interpretationsfähigkeit des Menschen? Wie lautet Ihre Meinung dazu?
Das Sammeln einigermaßen objektiver und möglichst vielfältiger Daten ist erstmal sinnvoll. Aber Sie haben natürlich Recht: Die Daten an sich sind bloße Informationen und noch kein Wissen. Um Wissen zu entwickeln, müssen die Daten tatsächlich erst in einen Zusammenhang gebracht und interpretiert werden. Die entsprechenden Fähigkeiten erschöpfen sich nicht in den formalen Methoden, sondern müssen kreative Kompetenzen einschließen.
Computer beherrschen den formalen Aspekt der Datenanalyse oft schon heute besser als Menschen. Für den Menschen kommt es darauf an, mit einem weiten Blick sinnvolle Fragen an die Daten zu formulieren, ihren Kontext im Auge zu behalten und über diesen hinaus eventuelle Sinnzusammenhänge mit ganz anderen Themenfeldern zu identifizieren.
Abschließende Frage: Sie selber schreiben, dass weltweite Vergleichsstudien zur Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten zeigen, dass in den vergangenen 100 Jahren die mit Intelligenzquotienten messbaren logisch-analytischen Fähigkeiten der Menschen weltweit gestiegen sind. Die Fähigkeit zur Kreativität scheint dagegen zum Beispiel in den USA oder Deutschland gesunken zu sein. Ist unser Ausbildungssystem vor diesem Hintergrund nicht vollkommen veraltet, wenn wir von Zukunftsfähigkeit und Digitalisierung sprechen?
Zumindest ist es modernisierungsbedürftig. In Zukunft wird eine breite und vor allem fundierte – also nicht einmal abgefragte und dann wieder vergessene – Allgemeinbildung wichtig. Eine hohe Qualifikation wird sich durch eine hohe Methodenkompetenz und einen weiten Horizont auszeichnen. Hinzukommen muss die Fähigkeit, interdisziplinär zu denken und Zusammenhänge herzustellen. Diese Fähigkeiten scheint das aktuelle Bildungssystem an Schulen und Hochschulen sogar eher zu verhindern als zu fördern.
Das Interview führte Marcus Klug mit Dirk Heilmann im Rahmen des Buchprojekts „Morgen weiß ich mehr. Intelligenter lernen und arbeiten nach der digitalen Revolution“.
Dirk Heilmann ist seit 1998 beim Handelsblatt und seit August 2009 Chefökonom der Zeitung. Seit Januar 2013 ist er zudem Managing Director des Handelsblatt Research Institute in Düsseldorf. 2005 bis 2009 war er als Büroleiter der Zeitung in London tätig, davor hat er das Ressort Unternehmen und Märkte geleitet. Heilmann hat zusammen mit dem ehemaligen Chef der Wirtschaftsweisen, Professor Dr. Bert Rürup, 2012 den Wirtschafts-Bestseller „Fette Jahre. Warum Deutschland eine glänzende Zukunft hat“ veröffentlicht.